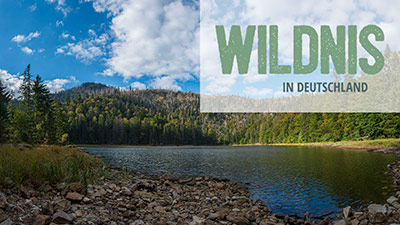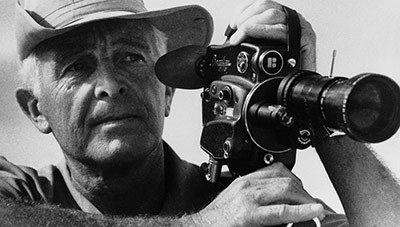Unsichtbar und heimtückisch, das Quecksilber aus der Goldgewinnung lässt die Fische im Reservat El Itilla in Kolumbien zum Gesundheitsproblem werden. Unterstützt von der ZGF sammeln indigene Fischer wissenschaftliche Daten, um die besonders belasteten Arten zu identifizieren.

Das unsichtbare Gift der Fische
Mit einem leisen Platschen gleitet das Paddel durchs pechschwarze Wasser. Es ist kurz nach Mitternacht, der Himmel ist wolkenverhangen, der Regen plätschert auf das Blätterdach des dichten Regenwaldes. Mauricio Gonzalez kniet am Bug seines selbstgebauten Holzfloßes, eine Taschenlampe in der Hand, den Blick konzentriert aufs Wasser gerichtet. Seit er acht Jahre alt ist, fischt er hier, wie schon sein Vater und sein Großvater. Die Tiere im Fluss sind für seine Familie nicht nur Nahrung, sondern Leben. Fast jeden Tag kommt morgens, mittags und abends Fisch auf den Teller, so wie bei allen, die im Nationalpark Serranía de Chiribiquete leben.
Seit einiger Zeit bedeutet Fisch für die indigene Bevölkerung hier in Kolumbien aber auch Gefahr. Denn viele der Flussfische sind kontaminiert. Beim Goldwaschen, einer weit verbreiteten Praxis im Amazonas, vermischen Goldsucher feinen Flusssand mit flüssigem Quecksilber. Das Metall bindet das Gold zu einem Amalgam. Wird dieses erhitzt, verdampft das Quecksilber und das Gold bleibt zurück. Der giftige Dampf gelangt ungefiltert in die Umwelt, Reste werden oft direkt in die Flüsse gekippt. Dort reichert sich das Quecksilber in den Fischen an – und im Körper der Menschen, die sie verspeisen.
Die Gefahr ist unsichtbar. Auch Mauricio Gonzalez wusste lange nichts vom gesundheitsschädlichen Quecksilber. Doch jetzt sammelt er als Teil einer Gruppe von engagierten Fischern Proben, um die Belastung der Fische zu analysieren.
Eine solche Untersuchung wird hier zum ersten Mal durchgeführt. Sie wurde möglich dank eines Projekts, das von der ZGF initiiert und von der Climate and Land Use Alliance (CLUA) gefördert wurde. Ziel ist es, die Vielfalt der lokalen Fischarten zu erfassen und den Quecksilbergehalt in den Arten zu bestimmen, die von den indigenen Gemeinschaften am häufigsten verzehrt werden. Viviana Londoño, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit bei der ZGF in Kolumbien, hat das Projekt für uns begleitet.
Die Ergebnisse sind alarmierend, wie Viviana berichtet: 30 Prozent der konsumierten Fischarten, die analysiert wurden, weisen Quecksilberwerte auf, die über den von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erlaubten Werten liegen. Das ergab die Untersuchung von 316 Proben, die zwischen September 2023 und Februar 2025 von acht Fischern und ihren Familien gesammelt wurden. Quecksilber verursacht irreversible neurologische Störungen und führt zu Entwicklungsschäden bei Kindern. Mit der Muttermilch kann es auch auf Neugeborene übergehen.
„Obwohl die Gefahren durch Quecksilber besorgniserregend sind, fehlt es vielen Indigenen an Wissen über die Auswirkungen“, sagt Viviana. „Genau hier setzt das Projekt an, damit die Gemeinschaften vor Ort fundierte Entscheidungen für ihre Gesundheit treffen können.“ Neben Schulungen zur fachgerechten Entnahme von Gewebeproben aus Fischen organisierte das Team der ZGF auch Infoveranstaltungen über die gesundheitlichen Folgen von Quecksilber, verständlich, praxisnah und gemeinsam mit den Menschen vor Ort.
Die 40 Familien der Gemeinschaft leben am Ufer des Río Itilla in einem Gebiet ohne Straßen und Mobilfunkempfang. Erst seit Kurzem gibt es dank Satellitenverbindung Internet. Das Herz der Gemeinschaft ist die Maloca, ein Versammlungsort und spirituelles Zentrum. Hier wurde auch beschlossen, mit der ZGF und dem Fischbiologen Yesid López zusammenzuarbeiten. Für die indigene Bevölkerung geht es ums Überleben, denn Fisch ist hier die wichtigste Proteinquelle.
Die Lage des Reservats stellt das Team vor logistische Herausforderungen. Yesid López etwa lebt in Bogotá, verbringt aber fast die Hälfte des Monats im Amazonasgebiet. Für jede Probenentnahme in El Itilla nimmt er einen einstündigen Flug nach San José del Guaviare auf sich, schläft dort, fährt am nächsten Morgen drei Stunden nach Calamar, dann zwei weitere Stunden in einem Tuk-Tuk bis zum Hafen Puerto Polaco. Dort wartet ein kleines Boot aus der Gemeinde und bringt ihn nach El Itilla.
Die Untersuchungen des Fischbiologen sind wichtiger denn je. Der Goldrausch vor Ort sowie der globale Hunger nach dem Edelmetall haben die Quecksilberbelastung der Fischpopulationen in den letzten zehn Jahren um mehr als 50 Prozent steigen lassen.
Die Proben sind das Herzstück der Analyse. Jeder Fischer fährt mit einem kleinen Holzfloß hinaus, in dem Platz für ein bis zwei Personen ist. Die Flöße, die förmlich mit dem Fluss verschmelzen, bauen die Fischer selbst aus dem Holz des Achapo-Baums. Meist fahren sie gegen 22 Uhr hinaus und kehren erst nach 1 Uhr morgens zurück. In diesen drei Stunden können sie während der Niedrigwasserzeit bis zu 20 Fische fangen. Das Wissen der Fischer über die lokale Fischpopulation und ihre traditionellen Fangmethoden leisten dabei einen wertvollen Beitrag.
Am nächsten Morgen werden die Fische gereinigt und entschuppt. Mauricios Töchter stehen dann meist schon bereit. Zusammen mit Yesid López vermessen sie die Tiere, bestimmen ihr Geschlecht und ihren Entwicklungsgrad und nehmen eine Gewebeprobe, rund ein Quadratzentimeter Muskel. Die Proben werden in Kühlboxen nach Bogotá geschickt und dort an Speziallabore weitergeleitet. Die Analyse dauert oft bis zu zwei Monate.
El Itilla ist das einzige indigene Territorium, das vollständig innerhalb des Nationalparks Chiribiquete liegt. Über 70.000 Felszeichnungen zieren die Tafelberge, auch Tepuis genannt. Manche von ihnen sind viele Jahrtausende alt. Die Gegend ist ein Hotspot der Biodiversität und ein Symbol für unberührte Natur.
„Indigene Völker sind die wichtigsten Hüter der Wälder unserer Erde“, sagt Viviana Londoño. „Ihre traditionellen Praktiken tragen entscheidend zur Erhaltung der Biodiversität bei. Deswegen ist ihr Wohlergehen so wichtig.“ In Zeiten von Klimawandel und Raubbau an der Natur sind sie „Barrieren gegen die Entwaldung“. „Doch ihr Beitrag wird oft unterschätzt oder gar nicht anerkannt“, sagt Viviana. Mit Projekten wie diesem könne sich das ändern.
Von Anja Schuller