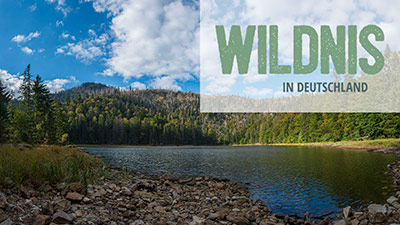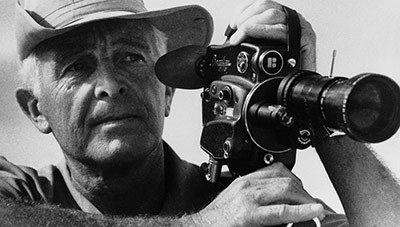Die ZGF arbeitet auf vier Kontinenten in 20 Ländern mit sehr unterschiedlichen Gegebenheiten. Von Esperanza Leal, der Direktorin der ZGF-Kolumbien, und Masegeri Rurai, dem Leiter unseres Serengeti-Programms in Tansania, wollten wir wissen, wie wichtig die Zusammenarbeit mit den Menschen ist, die angrenzend an die Schutzgebiete leben, in denen wir arbeiten.

Unsere wichtigsten Verbündeten im Naturschutz: Menschen
Dieser Artikel ist zuerst im Gorilla Magazin (Mai 2025) erschienen.
ZGF-Gorilla: Hallo Esperanza, hallo Masegeri, schön dass wir heute über drei Kontinente hinweg miteinander sprechen. Im Naturschutz ist oft von „lokalen Gemeinden“ die Rede. Gebt uns mal einen Überblick, was das in Kolumbien und Tansania bedeutet.
Esperanza Leal: Hier in Kolumbien definiert die Verfassung drei verschiedene Bevölkerungsgruppen, die jeweils unterschiedliche Rechte besitzen: die indigenen Gemeinschaften, die Gruppe der Afrokolumbianer und die sogenannten Mestizen, eine Mischung aus den beiden zuerst genannten und den vielen Europäern, die im Laufe der Geschichte hierherkamen. Ich selbst bin Mestiza. Lokale Gemeinden leben auf dem Land und können aus diesen drei Gruppen stammen.
Masegeri Rurai: Das ist interessant. In Tansania sind lokale Gemeinden Menschen, die in einer größeren Gruppe zusammen in einem bestimmten Gebiet leben. In der Regel haben sie dieselben Werte, sprechen dieselbe Sprache und haben eigene Traditionen. Von den 1960ern bis in die 90er-Jahre war Tansania ein sozialistisches Land. Per Verfassung ist geregelt, dass Menschen überall im Land wohnen dürfen, solange sie sich an die Gesetze halten. Und egal wo sie leben, solange es außerhalb von Städten ist, gelten diese Gruppen als lokale Gemeinden.


Esperanza, du hast von indigenen Gemeinschaften gesprochen, die andere Rechte haben, als andere Kolumbianer. Was meinst du damit?
Esperanza Leal: Die indigenen Gemeinschaften sind die Ureinwohner Kolumbiens, die bereits in Südamerika lebten, ehe die Europäer kamen und sie sind heute in der Minderheit. Der Großteil der Bevölkerung sind Mestizen. Von den 50 Millionen Einwohnern Kolumbiens sind nur zwei Millionen Menschen indigen. Dennoch sprechen sie über 90 verschiedene Sprachen. Und richtig, sie haben besondere Rechte, zum Beispiel kollektive Landrechte.
Masegeri Rurai: In Tansania machen wir keinen Unterschied zwischen lokalen und indigenen Gemeinden. Es gibt in Tansania mehr als 120 local tribes, also Stämme, die eigene Sprachen sprechen, und dort, wo sie ursprünglich gelebt haben, sind sie indigen. Aber seit den Jahren des Sozialismus sind Menschen im ganzen Land herumgezogen. Darum gibt es die gemeinsame Sprache Swahili, die in ganz Tansania gesprochen wird. Ich zum Beispiel spreche eigentlich Batemi. Und Massai sprechen Maa. Ohne Swahili könnten wir uns nicht verständigen. Und so wie Swahili die Menschen eint, so würde das Beharren auf indigenen Stämmen uns entzweien. Daher vermeiden wir in Tansania die Verwendung des Begriffes indigen. Ganz egal, wo du herkommst, jeder hat dasselbe Recht auf Land überall in Tansania. Und nicht auf ein bestimmtes Gebiet, wo dein Stamm ursprünglich mal gelebt hat.
Wie meinst du das, Masegeri: Recht auf Land?
Masegeri Rurai: Alles Land in Tansania gehört dem Staat. Und jede Tansanierin und jeder Tansanier kann den Staat um Land bitten, überall im Land. Ich habe zum Beispiel ein Stück Land in Arusha. Und in meinem Dorf Loliondo leben Menschen aus Südtansania und die haben nun Land dort. Man kann den Staat um das Nutzungsrecht bitten, das sogenannte Customary Right of Occupancy (CRO). Für 33, 66 oder 99 Jahre kann man dann das Land nutzen und bewirtschaften. Das ist im Village Land Act geregelt und gilt für ländliche Gebiete außerhalb von Schutzgebieten. In Städten ist es etwas anderes, da kann man auch Grundstücke kaufen.
Esperanza, kommen wir nochmal zurück zu den kollektiven Landrechten der Indigenen. Was bedeutet das genau?
Esperanza Leal: Indigene Gruppen besitzen gemeinsam das Land, in dem sie ursprünglich ansässig waren und sind. Das nennen wir indigenes Territorium. Dafür haben sie einen Landtitel. Dieses Land verwalten sie gemeinsam, es darf nicht verkauft, verpachtet oder eingetauscht werden und die wirtschaftliche Nutzung ist eingeschränkt, intensive Landwirtschaft in Monokulturen ist nicht erlaubt. Staatliche Großprojekte wie der Abbau von Bodenschätzen sind nur mit Zustimmung der indigenen Verwaltung möglich.
In ihren Territorien können indigene Gruppen ihre Traditionen und Sprachen, ihre Kultur und Lebensweise erhalten. Indigene Territorien sind oft sehr groß und überlappen in Teilen mit Nationalparks. Das ist in der Verfassung so festgelegt: Solange die indigenen Gemeinden zustimmen, kann ihr Territorium zusätzlich ein Schutzgebiet werden. Es gibt 800 solcher indigenen Territorien in Kolumbien, die insgesamt 30 Prozent der Landesfläche ausmachen. Und es gibt 61 nationale Schutzgebiete. Zu 30 Prozent überlappen diese mit indigenen Territorien. Vor allem im Amazonasgebiet ist das der Fall.
Wie wirkt sich das auf die Arbeit der ZGF in Kolumbien aus, Esperanza?
Esperanza Leal: Es ist schon eine Herausforderung, dass die Schutzgebiete mit indigenen Territorien überlappen. Aber das bietet zugleich auch viele Chancen. Denn die indigenen Gemeinschaften verfügen über großes Wissen, wie sie ihre Ressourcen am besten verwalten. Sie sind relativ wenige Menschen in riesigen Gebieten und nutzen das Land deshalb meist recht nachhaltig. Sie wissen, was sie tun.
Masegeri, überlappen in Tansania ebenfalls Schutzgebiete mit dem Land der Gemeinden? Und welche Herausforderungen bringt das mit sich?
Masegeri: Als Tansania 1961 unabhängig wurde, hatten wir einen Nationalpark, die Serengeti. Bevor es Schutzgebiete gab, lebten überall Menschen. Nach der Unabhängigkeit etablierte unsere Regierung weitere Nationalparks und Wildschutzgebiete (Game Reserves) oder Waldschutzgebiete (Forest Reserves). Diese dienen ausschließlich dem Naturschutz. Menschliche Aktivitäten und die Nutzung der Ressourcen sind dort gesetzlich untersagt. Das ist eine Herausforderung, denn die Menschen, die in der Nähe dieser Schutzgebiete leben, würden die Ressourcen gerne nutzen und tun das manchmal auch, unerlaubterweise. Das führt natürlich zu Konflikten.
Auch wenn die Regierung ein neues Schutzgebiet ausweist oder ein bestehendes erweitert. Dann müssen unter Umständen Leute umziehen. Sie erhalten dafür zwar eine Kompensation, aber verständlicherweise sind sie damit trotzdem nicht unbedingt zufrieden. Und weil die ZGF im Naturschutz arbeitet, bekommen wir manchmal zu hören „Euch sind die Tiere wichtiger als Menschen“. Das stimmt aber nicht. Zudem haben wir mit den Regierungsentscheidungen nichts zu tun.
Und was erwidert ihr dann?
Masegeri Rurai: Was richtig ist: Wir schützen die Natur für die Menschen. Für das Wohlergehen aller. Und das ist wichtig, denn außerhalb der Schutzgebiete geht es der Natur oft schlecht. Es gibt Entwaldung, Erosion, die Bodenqualität verschlechtert sich.
In diesem Heft zeigen wir eine Reihe von Beispielen, wo und wie Menschen angrenzend an Schutzgebiete, in denen wir arbeiten, in den Naturschutz integriert werden. Wie arbeitet ihr beispielsweise in Kolumbien mit indigenen Gemeinden zusammen?
Esperanza Leal: Mit indigenen Gemeinden zusammenzuarbeiten, erfordert eine ganz andere strategische Herangehensweise als etwas allein zu machen. Wir müssen immer da sein und im Austausch bleiben. Die Möglichkeit zum Dialog und für sogenannte Konsultationen muss dauernd gegeben sein. In Kolumbien arbeiten wir vor allem im Bereich des Monitorings natürlicher Ressourcen mit indigenen Gemeinden zusammen. Also, von Ressourcen, die sie nutzen.
Was heißt das konkret?
Esperanza Leal: Zum Beispiel machen wir seit elf Jahren ein gemeinsames Schildkrötenmonitoring. Wir nutzen die Fähigkeiten und die Manpower der Gemeinden, die monatelang die Brutstrände der Flussschildkröten überwachen. Hier in Kolumbien gibt es bewaffnete Rebellengruppen und wir können aufgrund dieser Situation nicht immer in den Schutzgebieten präsent sein. Die indigenen Gemeinden halten die Stellung, sie halten das Monitoring am Laufen und werden für ihre Arbeit natürlich bezahlt.
Neben den Schildkröten machen wir auch ein Chagra-Monitoring. Chagra sind indigene Gärten und eine Art traditionelle Landbewirtschaftung. Dort wird auf sehr traditionelle Weise in kleinen Polykulturen produziert. Hier arbeiten wir beim Monitoring vor allem mit älteren Frauen zusammen, sie sind die Expertinnen auf diesem Gebiet.
Wie gestaltet das Serengeti-Programm die Zusammenarbeit mit den lokalen Gemeinden, Masegeri?
Masegeri Rurai: Die Menschen hier sind unsere Partner im Naturschutz. Und natürlich stammen auch viele unserer Mitarbeitenden aus lokalen Gemeinden. Eine Gemeinsamkeit mit Kolumbien ist, dass sie das Ökosystem richtig gut kennen und über viel Wissen verfügen. Das ist sehr wertvoll und hilft uns bei gemeinsamen Aktivitäten.
Wir arbeiten nicht nur in Schutzgebieten, sondern auch in den angrenzenden Gebieten, also den Pufferzonen. Sie gehören zum selben Ökosystem und in diesen Gebieten gibt es viel Schützenswertes. Mit den Gemeinden, die dort leben, machen wir eine Landnutzungsplanung, wenn sie das wünschen. Dann unterstützen wir diesen Prozess finanziell und mit Trainings. Und legen gemeinsam fest, welche Gebiete künftig als Weidefläche, als Anbaufläche oder als Siedlungsgebiet genutzt werden. Hier greifen wir auf das traditionelle Wissen der Menschen zurück, denn sie wissen am besten, wo man besser keine Felder anlegt, weil regelmäßig Elefanten vorbeikommen.
Das klingt logisch.
Masegeri: Genau. Damit gibt es auch weniger Konflikte zwischen Menschen und Wildtieren. Hier in der Serengeti unterstützen wir zwei Gemeinde-Wildschutzgebiete, zum Beispiel die Ikona Wildlife Management Area. Fünf Dörfer waren 2007 an der Gründung beteiligt. Den Wildtieren geht es blendend und den Menschen auch. Die Gemeinden profitieren nämlich auch finanziell davon, beispielsweise über den Tourismus. Jährlich erwirtschaften diese fünf Dörfer zusammen inzwischen über eine Million US-Dollar.
Die Entwicklung der Gemeinden muss mit dem Naturschutz Hand in Hand gehen.
Du hast gesagt die ZGF unterstützt solche Vorhaben, wenn die Gemeinden das möchten. Heißt das, die Initiative geht nicht von uns aus?
Masegeri Rurai: Ja richtig, die Gemeinden kommen mit der Idee auf uns zu, dass sie ein bestimmtes Gebiet schützen möchten, wie beim Gemeindewald in Loliondo. Hier ging es ihnen darum, die Wasserressourcen zu schützen. Ohne die Gemeinden hätten wir die Ikona Wildlife Managemet Area und den Loliondo Community Forest nie realisieren können.
Wie kann der Naturschutz stärker zu einer nachhaltigen Entwicklung der Gemeinden beitragen?
Masegeri Rurai: Indem wir sicherstellen, dass sie noch besser von den Schutzgebieten profitieren, in deren Nähe sie leben. So wie im Fall der Ikona Wildlife Management Area! Die Entwicklung der Gemeinden muss mit dem Naturschutz Hand in Hand gehen. Darauf muss der Schwerpunkt liegen. Und wir müssen die Gemeinden dabei unterstützen, nachhaltiger zu leben. Sei es im Bereich umweltfreundlicher Landwirtschaft, Viehhaltung und auch Bodenschutz oder erneuerbare Energie.
Wir müssen alles tun, damit sie verträglich mit der Natur leben können. Die ZGF muss weiter mit den Gemeinden zusammenarbeiten, in Tansania und in den anderen Projektländern mit großer biologischer Vielfalt. Für die Zukunft, für die Menschen, die hier leben, und für alle Menschen auf unserem Planeten.
Vielen Dank für dieses interessante Gespräch, Esperanza und Masegeri.